Die Geschichte der Bücherverbote: 10 Empfehlungen
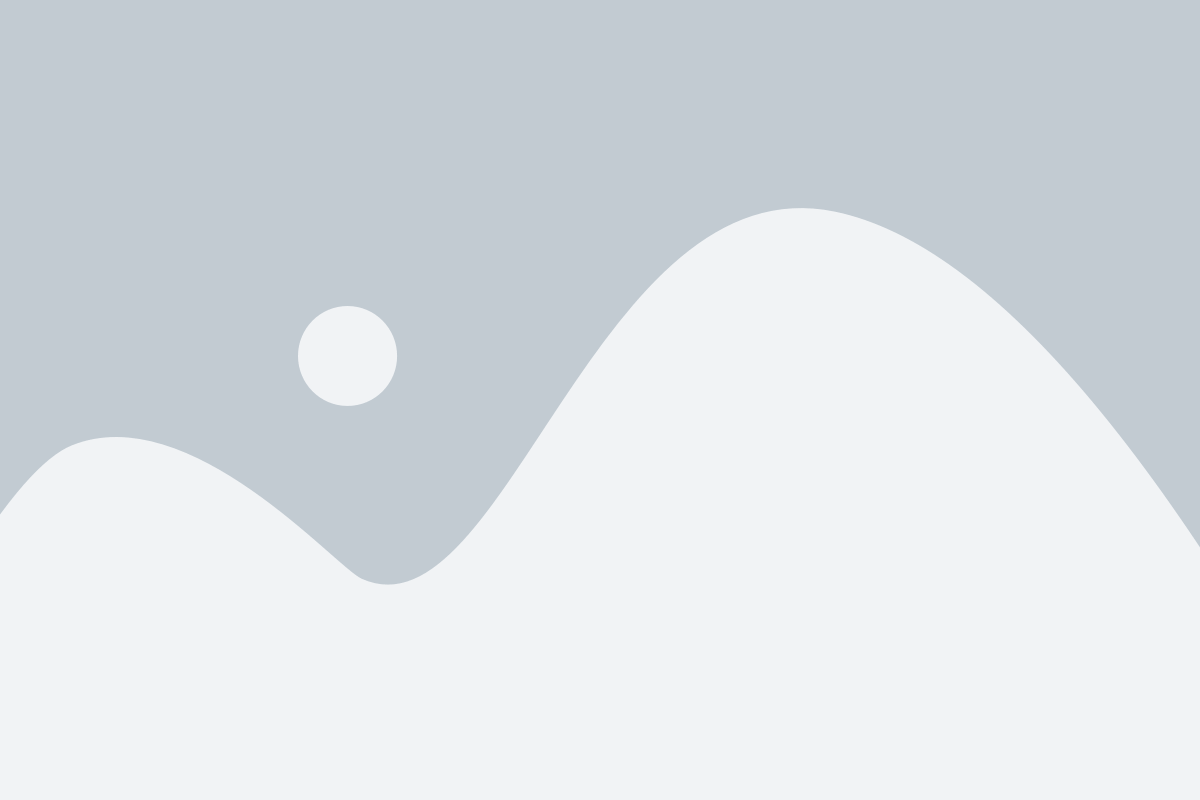
Wer gerne liest und sich mit Büchern beschäftigt weiss: immer wieder werden Bücher verboten, und das überall auf der Welt. Gerade aus den USA hört man immer öfter, dass Bücher aus Schulen und Bibliotheken entfernt und verboten werden.
Dass Bücher verboten werden, ist allerdings kein neues Phänomen. Buchverbote sind so alt wie die Erfindung des Buchdrucks selbst. So gab es zum Beispiel den «Index librorum prohibitorum» (zu Deutsch: Verzeichnis verbotener Bücher). Eingeführt im 16. Jahrhundert waren darin Bücher aufgelistet, die Katholik:innen nicht lesen durften. Als Strafe drohte der Ausschluss aus der Kirchengemeinde. 1966 wurde der Index dann formell abgeschafft.
Wer gerne liest und sich mit Büchern beschäftigt weiss: immer wieder werden Bücher verboten, und das überall auf der Welt. Gerade aus den USA hört man immer öfter, dass Bücher aus Schulen und Bibliotheken entfernt und verboten werden.
Dass Bücher verboten werden, ist allerdings kein neues Phänomen. Buchverbote sind so alt wie die Erfindung des Buchdrucks selbst. So gab es zum Beispiel den «Index librorum prohibitorum» (zu Deutsch: Verzeichnis verbotener Bücher). Eingeführt im 16. Jahrhundert waren darin Bücher aufgelistet, die Katholik:innen nicht lesen durften. Als Strafe drohte der Ausschluss aus der Kirchengemeinde. 1966 wurde der Index dann formell abgeschafft.
«Wider den undeutschen Geist»
Auch den Nazis waren viele Bücher ein Dorn im Auge. Es kommt zu den berühmten Bücherverbrennungen zwischen März und Oktober 1933. Im Rahmen der Kampagne «Wider den undeutschen Geist», fanden 102 Bücherverbrennungen in mehr als 90 Städten statt. Insgesamt sind die Werke von hunderten Schriftstellern:innen betroffen, darunter viele jüdische Autoren:innen, aber auch andere politische Gegner. Zu den bekanntesten Namen gehören unter anderem Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Carl von Ossiezky oder Heinrich Mann. Letzterer legte seinem Protagonisten Hassan in seinem Werk «Almansor» bereits die Worte in den Mund: «Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen». Geschrieben im Jahr 1820, sollten diese Worte sich nur wenige Jahre nach den Bücherverbrennungen 1933 bewahrheiten.
«Schundliteratur»
Auch in der Schweiz wurde schon versucht, zu kontrollieren, was die Bevölkerung lesen sollte und was nicht. 1965 sind es vor allem Comics, die als niedere Literatur bezeichnet werden. Sie werden dafür verantwortlich gemacht, dass Jugendliche zunehmend aufmüpfig werden und sich Autoritäten widersetzen. Ein Lehrer aus dem aargauischen Brugg nimmt die Sache schliesslich selbst in die Hand. Er beauftragt Jugendliche, die «Schundliteratur» einzusammeln, um sie öffentlich zu verbrennen und gegen «gute» Literatur einzutauschen. Unterstützt wird die Aktion von Bundesrat Philipp Etter, während die Migros und Ex Libris die Aktion sponsern. Die negative Haltung in der Bevölkerung gegen die sogenannte «Schundliteratur» weitete sich auf die ganze Schweiz aus.
Immer mehr Bücher werden verboten
Das Phänomen der Buchverbote hat sich bis heute erhalten – an manchen Orten der Welt mehr als an anderen. In Ungarn wird es Jugendlichen und Kindern zunehmend schwer gemacht, Bücher über Homosexualität und Transidentität zu lesen. Dahinter steckt ein Gesetz der Regierung unter Viktor Orbán. Es soll verhindern, dass junge Menschen Zugang zu Informationen über queere Themen bekommen. So müssen diese Werke in Buchhandlungen in undurchsichtige Folie verpackt sein und dürfen nicht in der Nähe von Schulen oder Kirchen verkauft werden.
Besonders medienwirksam sind die Bücherverbote im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, den USA. Gemäss dem amerikanischen Autorenverband PEN (Poets, Essayists, Novelists) America wurden in den Jahren 2023 bis 2024 über 10’000 Bücher an öffentlichen Schulen verboten. Die Tendenz ist steigend. Mehr als 72% der Verbote gehen auf die Initiative christlich-konservativer Kreise zurück. Besonders betroffen sind Werke, welche sich mit queeren Themen oder Rassismus auseinandersetzen. Als Begründung werden gerade erstere als «pornografisch» dargestellt – als etwas, wovor man die Kinder schützen muss. Statt queerer Literatur soll in einigen Schulen die Bibel zurück in die Schulzimmer kommen, und das trotz der ausgeprägten Darstellungen von unter anderem (sexueller) Gewalt.
Read banned books!
Doch wie bei vielen Verboten liegt gerade darin der Reiz: Was verboten ist, macht neugierig. So auch bei Büchern. Viele Bibliotheken und Buchhandlungen widmen den «banned books» sogar eigene Regale. Die folgenden zehn Empfehlungen wurden im Laufe der Zeit zensiert oder verboten. Die meisten Werke sind in den USA verboten und sind im Index von PEN America zu finden.
Gender Queer: A Memoir – Maia Kobabe (2019)
In diesem autobiografischen Werk beschreibt Maia Kobabe die lebenslange Suche nach sich selbst. Aufgewachsen in den 90ern erlebt Maia neben den typischen Schwärmereien, Freundschaften, Familienkrisen und Schulstress eines Teenagers, auch ein Unwohlsein mit sich selbst. Als Mädchen fühlt sich Maia fehl am Platz, doch auch ein Junge will Maia nicht sein.
Gender Queer wurde in den letzten Jahren in vielen Schulbezirken wie Texas, Florida, Utah und Missouri verboten. Wie bei vielen Büchern queerer Autor:innen werden als Gründe für das Verbot die Darstellung von Sexualität und Thematisierung queerer Identitäten, die für Kinder unangebracht seien, angegeben.
Maus – Art Spiegelman (1986)
Im Comic Maus verarbeitet der Autor die Geschichte seines Vaters Wladek Spiegelman, einem Holocaust-Überlebenden. Das Buch zeigt, was Vladek in Polen zur Zeit des Nationalsozialismus erlebt hat – wie er verfolgt wurde, sich verstecken musste und ins Konzentrationslager Auschwitz kam. Gleichzeitig geht es auch um die Beziehung zwischen Vater und Sohn und darum, wie schwer es ist, über so schlimme Erlebnisse zu sprechen. Dabei werden die Juden als Mäuse dargestellt und die Deutschen als Katzen.
Der Comic wurde schon mehrfach verboten. Als Grund hielten meistens die Darstellungen von Nacktheit, Gewalt und Suizid, sowie die unangemessene Sprache her.
Das Tagebuch der Anne Frank – Anne Frank (1947)
Es ist wohl eines der bedeutendsten Werke über den Holocaust. Die jüdische Familie Frank versteckte sich zur Zeit der Judenverfolgung in einem Hinterhaus in Amsterdam. Im Tagebuch schilderte die Tochter Anne Frank ihre Beobachtungen, Gedanken und Gefühle. Sie schrieb über die Angst, entdeckt zu werden oder vor Bombenangriffen. Bis zum Schluss bleibt die Hoffnung des jungen Mädchens bestehen. Traurigerweise wird die Familie Frank schliesslich entdeckt und in einem Konzentrationslager getötet – und das kurz vor Kriegsende 1945.
Das Tagebuch der Anne Frank wurde unter anderem in Florida, Texas und Virginia verboten. Begründet wird dies mit der Thematisierung politischer Initiativen und Sexualität.
The Handmaid’s Tale – Margaret Atwood (1985)
Im Buch The Handmaid’s Tale findet sich die Leserschaft in einer dystopischen Welt wieder. Ein grosser Teil der Frauen ist nach einer atomaren Verseuchung unfruchtbar. Die Frauen werden in drei Gruppen eingeteilt: Ehefrauen von Führungskräften, Dienerinnen und Mägde. Die Mägde (engl. Handmaids) sind fruchtbar und sollen für unfruchtbare Ehefrauen Kinder empfangen. Eine von ihnen ist die Magd Desfred, deren Hoffnung zu entkommen noch nicht erloschen ist.
Das Werk wurde von konservativen Gruppen als «unangemessen» bewertet und unter anderem in den Bezirken Texas und Virginia entfernt – meist wegen Beschwerden aufgrund der Sexszenen, der religiös-politischen Dystopie und der feministischen sowie gesellschaftskritischen Inhalten.
The Hate U Give – Angie Thomas (2017)
Die 16-jährige Starr führt eine Art Doppelleben. Sie wächst in einer armen Gegend auf, geht aber auf eine Privatschule, wo sie fast die einzige Schwarze Frau ist. Ihr Leben wird aus der Bahn geworfen, als sie zusieht, wie ihr bester Freund Khalil vor ihren Augen von der Polizei erschossen wird. Der Vorfall wird von den Medien aufgegriffen und kurz darauf bilden sich zwei Lager. Die einen stempeln den verstorbenen Khalil als Gangmitglied ab, während die anderen auf die Strasse gehen und Gerechtigkeit fordern. Im Zentrum steht die Frage, was an jenem Abend wirklich geschah. Die Antwort darauf hat nur Starr selbst.
Das Buch behandelt Polizeigewalt gegen Schwarze, systemischen Rassismus und politische Instrumentalisierung, hat aber auch queere und feministische Bezüge. Genau deswegen wurde The Hate U Give in mindestens 17 US-Schulbezirken verboten.
1984 – George Orwell (1949)
1984 ist ein dystopischer Roman über einen totalitären Staat. Die Regierung, angeführt von der allmächtigen Figur «Big Brother», kontrolliert nicht nur das Verhalten, sondern auch die Gedanken der Bürger:innen durch ständige Überwachung, gezielte Sprachverarmung (Neusprech) und Manipulation der Wahrheit. Im Zentrum steht Winston Smith, ein Geschichtsfälscher der für das «Ministerium für Wahrheit» arbeitet. Er verliebt sich in die geheimnisvolle Julia, mit der er beginnt, die totalitäre Weltordnung in Frage zu stellen und sich in grosse Gefahr begibt.
Der Klassiker 1984 wird vor allem in konservativen Kreisen nicht gerne gesehen. Die Thematisierung staatlicher Überwachung und Manipulation von Wahrheit wird oft als «politisch provokant» eingestuft und ist Grund für zahlreiche Zensurinitiativen, etwa in Florida.
The perks of being a wallflower – Stephen Chbosky (1999)
Im Zentrum dieses Jugendromans steht der Teenager Charlie, der sehr schüchtern und in sich gekehrt ist. Am meisten erfährt man über ihn durch die Briefe, die er an eine Person schreibt, deren Name, Alter und Geschlecht nicht bekannt sind. Er verarbeitet darin die Probleme, die sein Leben prägen: von alterstypischen Verlebtheiten, Freundschaften, Experimente mit Drogen und Sexualität bis zu Schicksalsschlägen wie dem Selbstmord seines besten Freundes.
In den USA wird das Buch immer wieder verboten, vor allem wegen der Darstellung von Sexualität, Missbrauch, queerer Identitäten, Drogenkonsum und psychischen Problemen.
Märchenland für alle – Andrea Tompa, Judit Ágnes Kiss und Petra Finy (2022)
Märchenland für alle ist ein Kinderbuch, das 17 ungarische Märchen neu und zeitgemäss erzählt. Die Geschichten handeln von Vielfalt, Gleichberechtigung, Armut, Gewalt und dem Hinterfragen von starren Geschlechterrollen. Dabei spielen auch queere Figuren und Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen zentrale Rollen.
In Ungarn sorgte das Buch für Furore. Dort gilt ein Gesetz, das es Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren erschwert, Zugang zu Informationen über queere Themen zu bekommen. Deshalb wurde Märchenland für alle aus vielen Schulen verbannt und darf nur eingeschränkt verkauft werden – ähnlich wie andere queere Kinder- und Jugendbücher.
Erich Kästner – Fabian: die Geschichte eines Moralisten (1931)
Der Roman spielt im Berlin der späten Weimarer Zeit. Im Zentrum steht Jakob Fabian, etwa 30 Jahre alt, arbeitsloser Germanist, der sich mit einem Job als Werbetexter über Wasser hält. Er streift durch die Grossstadt, beobachtet, wie die Gesellschaft politisch und moralisch immer mehr zerfällt, und begegnet dabei viel Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit und sozialer Ungerechtigkeit. Anfangs bleibt Fabian eher distanziert und sieht allem mit ironischem Blick zu, ohne wirklich einzugreifen. Doch als er sich ernsthaft verliebt und sein bester Freund sich das Leben nimmt, beginnt er, seine Haltung zu überdenken.
Heute ist das Buch nicht mehr verboten, war jedoch Teil der Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten. Kästner selbst sah mit eigenen Augen zu, als seine Werke verbrannt wurden.
All Boys aren’t Blue – George Matthew Johnson (2020)
In diesen YA-Memoiren erzählt der Journalist und LGBTQ+-Aktivist George M. Johnson von seiner Kindheit, Jugend- und Collegezeit – und davon, wie es ist, als junge, schwarze, queere Person seinen Platz in der Welt zu suchen. Offen und ehrlich spricht Johnson über Erfahrungen, die ihn geprägt haben: von ausgeschlagenen Zähnen, über erste sexuelle Begegnungen, bis hin zur innigen Beziehung zu seiner Grossmutter. Dabei thematisiert er Geschlechtsidentität, toxische Männlichkeit, Brüderlichkeit, Familie, Ungleichheit, Zustimmung, und nicht zuletzt schwarze Freude.
All Boys aren’t Blue ist eines der am häufigsten verbotenen Bücher in den USA. In Missouri wurde die Behörde von Schüler:innen verklagt, nachdem das Buch aus allen Schulbibliotheken entfernt wurde.
Wer Bücher über queere Identitäten, Rassismus oder andere Minderheiten verbietet, will nicht nur Inhalte zensieren, sondern Realitäten ausblenden. Doch Menschen verschwinden nicht, nur weil ihre Geschichten aus den Regalen verbannt werden. Gerade deshalb ist Lesen mehr als eine Freizeitbeschäftigung – es ist ein politischer Akt. In einer Zeit, in der Zensur mit alten Narrativen salonfähig gemacht wird, ist es wichtiger denn je, diesen Stimmen Raum zu geben. Denn wie Autor Ray Bradbury sagte: «Man muss keine Bücher verbrennen, um eine Kultur zu zerstören. Es reicht, wenn man die Menschen vom Lesen abhält.»

